Damit macht ein Produkt Karriere, dessen Image und Name sich in den letzten Jahren gewandelt haben. In Österreich in den 1990er Jahren schon als „Solarkraftzwerg“ eingeführt, in Deutschland ab den 2010er Jahren unter dem Namen „Guerilla-Photovoltaik“ noch mit subversivem Touch diskutiert, sind die Module heute längst ein Standardprodukt, das es auch im Baumarkt gibt. Das aber schützt nicht vor Enttäuschungen, wie mitunter Nutzer schon feststellen mussten. Denn der Stromertrag und die ökonomische Rentabilität hängen von einigen Faktoren ab, die man kennen sollte.
Bis zu 2000 Watt
Verbreitet sind inzwischen Module mit etwa 400 Watt. Nach der neuesten Gesetzgebung der Bundesregierung sind somit also zwei reguläre Module zulässig. Theoretisch darf man zwar noch mehr Module installieren, laut neuestem Gesetz sogar in der Summe mit bis zu 2000 Watt – doch der Wechselrichter darf die Grenze von 800 Watt nicht überschreiten. Warum sollte man das tun? Eine Motivation, die Modulleistung deutlich höher auszulegen als die Leistung des Wechselrichters, könnte darin bestehen, dass man so die Zahl der Stunden erhöht, in denen man tatsächlich die zulässigen 800 Watt verfügbar hat.
Stromkreis überlastet
Die Limitierung der Einspeiseleistung ist sicherheitstechnisch begründet, denn bei höheren Stromflüssen könnten Stromkreise der Hausinstallation überlastet werden. Für grössere Solarstromanlagen ist daher ein regulärer Anschluss über einen separaten Einspeisepunkt vorgeschrieben.
Bürokratische Hürden reduziert
Mit dem sogenannten „Solarpaket 1“ der deutschen Bundesregierung wurden jüngst auch bürokratische Hürden reduziert (siehe ee-news.ch vom 29.4.24 >>). Bisher mussten die Module beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet werden. In Zukunft reicht eine Registrierung beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur aus. Im Vergleich zu fest installierten Dachanlagen soll der Vorgang zudem auf wenige Angaben beschränkt sein.
Installation Zweirichtungszähler
Ausserdem soll der Betrieb der Geräte für eine Übergangszeit auch ohne den sofortigen Austausch des Stromzählers erlaubt sein. Die Installation einer modernen Messeinrichtung als Zweirichtungszähler oder als intelligentes Messsystem („Smart Meter“) kann dann zeitverzögert erfolgen und wird vom zuständigen Messstellenbetreiber veranlasst, also in der Regel vom ortsansässigen Stromunternehmen.
Was kann die Anlage an Ertrag bringen?
Die besagten 800 Watt sind natürlich nur ein rein technischer Kennwert des Systems. Wie viele Kilowattstunden damit im Jahr erzeugt werden, hängt davon ab, wie viel Sonne auf die Module fällt. Bei einer gut ausgerichteten Dachanlage, die weitgehend unverschattet ist, geht man als Faustregel von 1000 Kilowattstunden pro installiertem Kilowatt aus. Folglich können dort mit 800 Watt rund 800 Kilowattstunden im Jahr zusammen kommen.
Online-Ertragsrechnertool
Am Balkon ist der Ertrag in der Regel geringer. Das hängt zum einen mit der Ausrichtung zusammen, denn in der Mehrzahl der Fälle werden die Module senkrecht montiert. Am unverschatteten Südbalkon sind dann rund 70 Prozent dessen möglich, was eine gute Dachanlage bringt – bei 800 Watt folglich etwa 500 bis 600 Kilowattstunden im Jahr. Einen detaillierten Rechner zu diesem Thema bietet die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin auf ihrer Internetseite an >>.
Weist der Balkon nicht exakt nach Süden, ist das relativ unkritisch; im Bereich zwischen Südwest und Südost sind die Mindererträge gegenüber einen Südbalkon gering. Aber selbst eine Ost- oder Westausrichtung dürfte bei dem obigen Beispiel mit 800 Watt noch für rund 450 Kilowattstunden Jahresertrag reichen.
Teils hohe Abschläge
Die grosse Einschränkung bei all diesen Berechnungen liegt nun im Wort „verschattungsfrei“. Bei einer „mittleren Verschattung“ – wie auch immer man diese definiert – rechnet die HTW Berlin mit Abschlägen von 25 bis 30 Prozent gegenüber einem vergleichbaren unverschatteten Standort. Bei 800 Watt in Südausrichtung kämen somit noch etwa 400 Kilowattstunden im Jahr zusammen, bei Ost- oder Westausrichtung etwa 320 bis 350 Kilowattstunden.
Gleichzeitiger Verbrauch
Bei der ökonomischen Betrachtung kommt dann vor allem ein weiterer Faktor ins Spiel: Welchen Anteil des selbst erzeugten Stroms kann man im Haus selbst verbrauchen? Denn die Amortisation der Balkonmodule geschieht durch Senkung des Strombezugs aus dem Netz. Wenn eine Balkonanlage 800 Watt erzeugt, der zeitgleiche Verbrauch aber bei nur 100 Watt liegt, ist der finanzielle Vorteil in diesem Moment gering.
Je mehr Leistung man am Balkon installiert hat, umso niedriger wird naturgemäss der Anteil, den man selbst nutzen kann. Bei einem 300-Watt-Modul geht die HTW für einen Zwei-Personen-Haushalt davon aus, dass dieser noch 89 Prozent seines Solarstroms selbst nutzen kann, bei 600 Watt sinkt der Wert auf 75 Prozent.
Zu viel für die Grundlast
Aber auch das sind natürlich nur grobe Schätzwerte. Denn sie hängen stark von den Lebensgewohnheiten der einzelnen Haushalte ab. Wer morgens früh aus dem Haus geht und abends erst zurückkommt, kann schliesslich weniger des eigenen Stroms nutzen, als Haushalte, bei denen immer jemand zuhause ist und mittags kocht. Nur für die Grundlast, die auch in Abwesenheit gedeckt werden kann – Kühlschrank, Router und dergleichen – kann auch ein Modul schon fast zu viel sei.
Und ein Speicher?
Womit die Frage bleibt, ob sich für Balkonmodule Speicher lohnen. Diese Frage hatte schon im letzten Sommer der Solarenergie-Förderverein (SFV) mit Sitz in Aachen – unterstützt durch den Freiburger Verein Balkon.Solar – ausführlich beantwortet. Das Fazit des SFV damals: Speicher für Balkon-PV seien „weder wirtschaftlich noch ökologisch“.
Auch im Buch „Balkon-Photovoltatik-Anlagen“, das die beiden Freiburger Solarexperten Rolf Behringer und Sebastian Müller im vergangenen Jahr herausbrachten, heisst es zum ersten kommerziell erhältlichen Speicher für Balkonsolar: „Die Kosten sind es, die diese Systeme im Moment auf jeden Fall unrentabel machen.“ Aber das kann sich natürlich ändern – und je teurer die Kilowattstunde aus dem Netz wird, umso rentabler wird auch die Speicherung.
Buch „Balkon-Photovoltatik-Anlagen“>>
©Text: Bernward Janzing
Wir freuen uns, wenn dieser Beitrag für Sie einen Mehrwert brachte. Unterstützen Sie uns – auch per Twint! >>
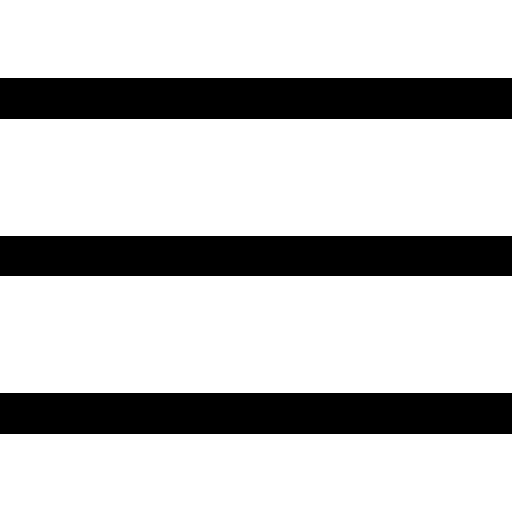
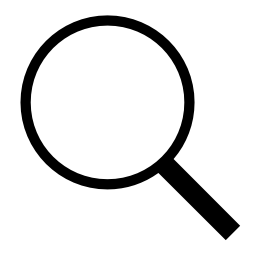

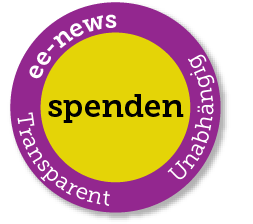




0 Kommentare